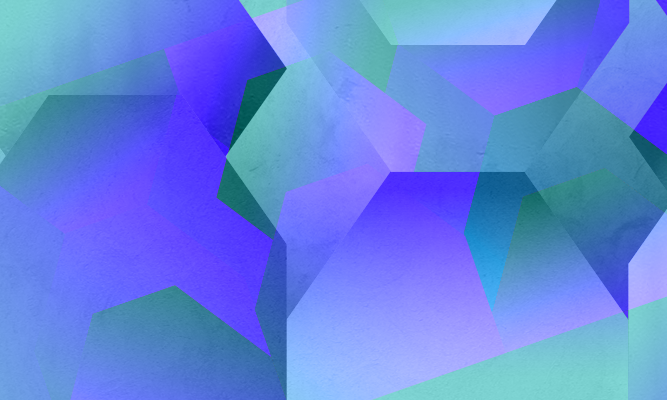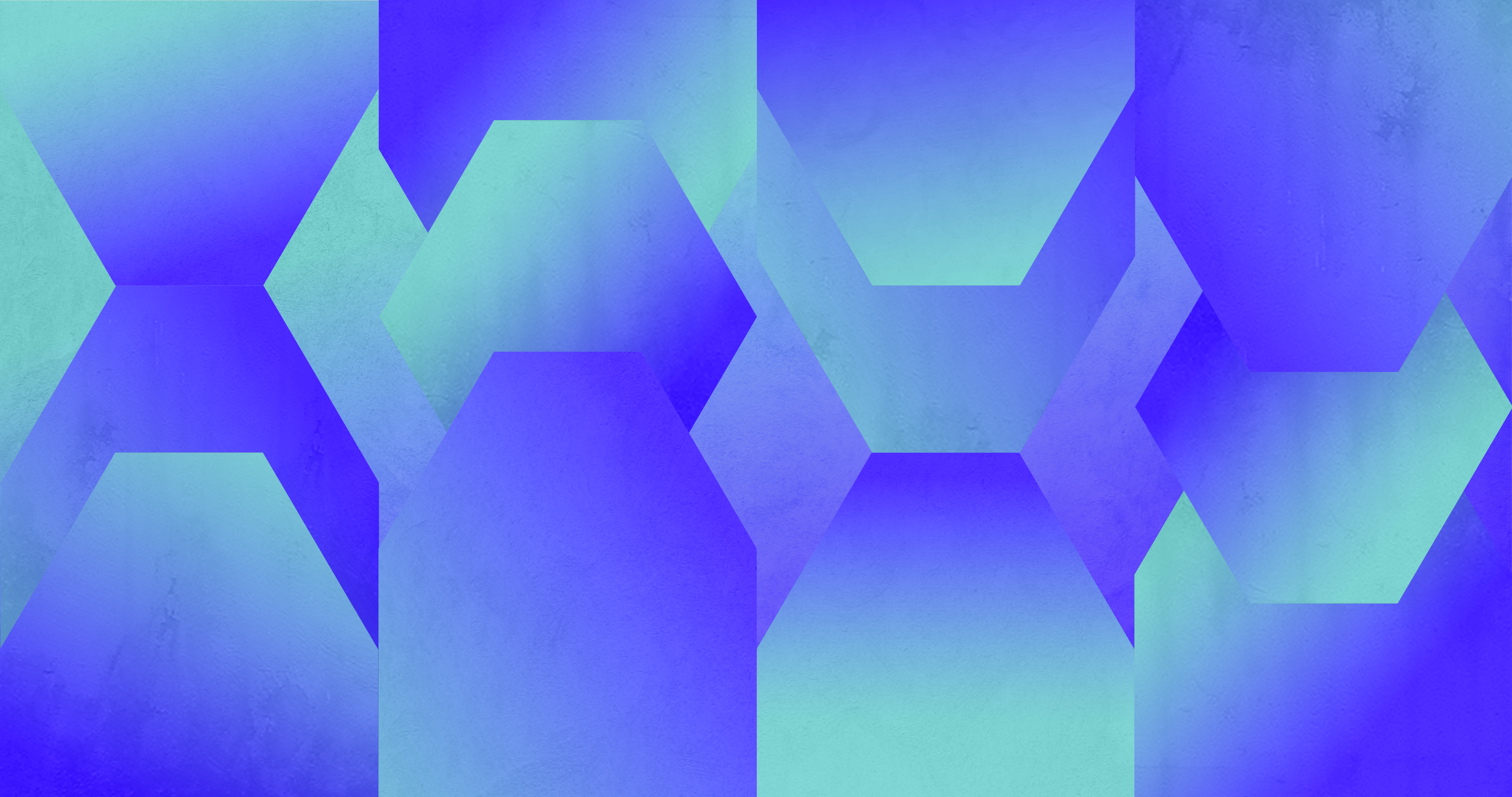
Queer beraten
wie queersensible Beratung gelingen kann
eine Online Praxishilfe
Praxishilfe für niedrigschwellige Beratungsstellen: Sensibilisierung für LSBTIQ+
Willkommen auf der Webseite, die als Unterstützung und Orientierung für Fachkräfte in niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsstrukturen dient. Ziel dieser Plattform ist es, die besonderen Bedarfe von LSBTIQ+ sichtbar zu machen und praktische Handlungsempfehlungen zu geben.
Diese Webseite adressiert Berater*innen aus den Bereichen der Gesundheit und Sozialen Arbeit, der Schulden- und Insolvenzberatung, der Wohnungssuche und anderen Bereichen sozialer Unterstützungsstrukturen.
Allgemeines / Zur Seite
Diese Webseite dient als Annäherung an das Thema Queersensibilität in Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Entscheidend für nachhaltige Veränderungen ist jedoch die Verbindung mit weiteren Bildungs- und Austauschformaten wie:
Die Kombination aus digitalen Werkzeugen und direktem Austausch soll dazu beitragen, LSBTIQ+ Personen zu unterstützen und Beratungsstrukturen nachhaltig zu verändern.
Niedrigschwellige Beratungsangebote im Bereich Armutsbekämpfung spielen eine zentrale Rolle für die Unterstützung von Menschen in prekären Lebenslagen. Das Aufsuchen solcher Stellen ist in der Regel mit Hürden verbunden. Für LSBTIQ+ gibt es zusätzliche Herausforderung, die eine diskriminierungssensible Herangehensweise erfordern. Queerfeindliche Diskriminierungen sowie die oft unzureichende Berücksichtigung ihrer Lebensrealitäten führen dazu, dass LSBTIQ+ ein erhöhtes Risiko haben, Erfahrungen mit Armut, Wohnungslosigkeit oder anderen prekären Lebenssituationen machen zu müssen. Verschärft wird dieses Risiko, wenn mehrere Diskriminierungsdimensionen – beispielsweise aufgrund von Rassismus, Ableismus oder Klassismus – aufeinandertreffen. Ein intersektionaler Ansatz, der diese Zusammenhänge sichtbar macht, ist daher essenziell, um LSBTIQ+ in ihrer Vielfalt und ihren Bedarfen angemessen zu unterstützen. Folgende Herausforderungen verdeutlichen die Notwendigkeit der Ergänzung vorhandener Angebote um queersensible Perspektiven:
Erhöhte Zugangsbarrieren
Schlechte Erfahrungen führen zu negativen Vorannahmen und verstärken die Hürde, Beratungsstellen aufzusuchen.
Risikoabwägung
Negative Erfahrungen führen dazu, dass LSBTIQ+ häufig abwägen, ob sie Beratungsangebote überhaupt in Anspruch nehmen können. Oft wird befürchtet, dass die Thematisierung von Diskriminierung zu Nachteilen führen könnte, weshalb diese nicht angesprochen oder gemeldet wird.
Selbstschutz durch Verstecken
LSBTIQ+ vermeiden es häufig, soweit möglich, sich zu outen. Das kann dazu führen, dass ihre tatsächlichen Bedarfe in Beratungsprozessen nicht erkannt werden.
Ungenügende Kapazitäten queerer Beratungsstellen
Allgemeine Sozialberatungsbedarfe können von queeren Beratungsstellen nicht vollständig abgedeckt werden. Gleichzeitig scheuen sich viele LSBTIQ+, explizit queere Angebote aufzusuchen, da sie fürchten, ungewollt von anderen LSBGTIQ+ aus der Community erkannt zu werden.
Die Webseite wurde entwickelt, um Fachkräfte in ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Inhalte dieser Website basieren auf den Expertisen und Recherchen der Verfasser*innen sowie auf Hintergrundgesprächen dieser mit Expert*innen aus verschiedenen Praxisfeldern der Beratungs- und Unterstützungsarbeit mit queeren Perspektiven. An dieser Stelle bedanken wir uns bei Nazila Karimy (von Gladt e.V.), Trans*Sexworks und allen anderen, die uns dabei unterstützt haben.
Die Verfasser*innen dieser Webseite sind unterschiedlich in gesellschaftliche Machtverhältnisse eingebunden und verorten sich u. a. als weiß und People of Colour, lesbisch und genderqueer.
Auch wenn die Verfasser*innen versucht haben, verschiedene Perspektiven einzubeziehen, bilden die Inhalte nur einen begrenzten Ausschnitt dieser vielfältigen Erfahrungen ab. Daher verstehen wir diese Webseite als ein Werkzeug, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. und laden Lesende ein, eigene Perspektiven und Erfahrungen einzubringen, um das Thema weiter zu bereichern. Diese können an queerhome@sonntags-club.de gesendet werden.
Unsere Inhalte verstehen sich als Impulse, um bestehende Beratungsangebote zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Sie sind keinesfalls eine vollständige Abbildung queerer Lebensrealitäten. Diese Webseite ist ein erster Schritt, der durch weitere Austauschformate ergänzt werden muss, um Wissen zu vertiefen, zu erweitern und in die Praxis umzusetzen. Ein entscheidender Vorteil des digitalen Formats ist seine überregionale Reichweite: Die Inhalte der Webseite sind nicht nur in Berlin und deutschlandweit zugänglich, sondern können auch international genutzt werden, um Sensibilisierung und Wissen zu fördern.
Diese Praxishilfe orientiert sich an zentralen politischen Strategien wie dem bundesweiten Aktionsplan „Queer leben“ und dem Berliner LSBTIQ+ Aktionsplan 2023. Beide Pläne betonen das Ziel, die Gleichberechtigung, Sicherheit und Selbstbestimmung von LSBTIQ+ Personen in allen Lebensbereichen zu fördern.
Weitere Informationen dazu finden Sie in den offiziellen Dokumenten:
sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
Grundlagenwissen
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans*, Inter* und queere (LSBTIQ+) Personen erleben oft Benachteiligung aufgrund von Diskriminierung, die sich auf ihre sexuelle Orientierung, Geschlechtsidentität, den Ausdruck ihres Geschlechts oder körperliche Geschlechtsmerkmale bezieht (SOGIESC)[1]. Homo-, Trans- und Interfeindlichkeit (im Folgenden: Queerfeindlichkeit) schränken ihre Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe strukturell ein. Die Lebensrealität vieler LSBTIQ+-Personen ist aufgrund von Queerfeindlichkeit strukturell geprägt von Ausgrenzung, Benachteiligung und physischer wie psychischer Gewalt. Wenn zusätzlich andere Diskriminierungsformen wie Rassismus[2], Klassismus[3], Antisemitismus[4], Altersdiskriminierung[5] und/oder andere dazukommen, steigt das Risiko, benachteiligt zu werden, noch weiter an.
Im Alltag zeigt sich das in vielen Lebensbereichen: LSBTIQ+ stoßen häufiger auf Probleme im Bildungssystem, am Arbeitsplatz, bei der Jobsuche oder bei der Wohnungssuche. Oft können sie ihre Lebensweise nicht frei und selbstbestimmt gestalten. Das erhöht das Risiko für Armut, die wiederum Probleme wie Wohnungslosigkeit, Gesundheitsprobleme oder Schulden nach sich ziehen kann. Auch wenn LSBTIQ+ eine sehr vielfältige Gruppe sind, haben sie eines gemeinsam: Sie erleben Diskriminierung durch eine Gesellschaft, die von heteronormativen und binären (also zweigeschlechtlichen) Vorstellungen geprägt ist. Beispielsweise in folgenden Bereichen der gesellschaftlichen Teilhabe sind LSBTIQ+ häufig benachteiligt:
LSBTIQ+ sind in der Öffentlichkeit einem hohen Risiko ausgesetzt, Opfer von Hasskriminalität zu werden. Die Zahl solcher Fälle ist in den letzten Jahren stark gestiegen: Für 2023 wurden in Deutschland 1499 Straftaten im Bereich „sexuelle Orientierung“ und 854 im Bereich „geschlechtsbezogene Diversität“ gemeldet. Trotzdem melden viele Betroffene Übergriffe nicht, oft aus Angst vor queerfeindlichen Reaktionen auch bei der Polizei. Laut einer EU-Umfrage von 2024 zeigt nur etwa jede zehnte Person physische Angriffe oder sexualisierte Gewalt an – die Dunkelziffer ist daher vermutlich vielfach höher.
Besonders trans und inter Personen sind in etwa doppelt so häufig von Gewalt getroffen wie LSBTIQ+ im Durchschnitt. Neben körperlicher Gewalt erleben LSBTIQ+ in der Öffentlichkeit, in sozialen Medien oder auch im privaten Umfeld Diskriminierung, z. B. durch Beleidigungen, Ausgrenzungen und mangelnde Sensibilität. Trans Personen machen in diesen Bereichen noch schlechtere Erfahrungen als die Gruppe LSBTIQ+ insgesamt. Auch diese Diskriminierungserfahrungen werden selten an offizielle Stellen gemeldet, so dass die Dunkelziffer ebenfalls hoch ist.
Das Risiko für Diskriminierung und Gewalt steigt zusätzlich, wenn LSBTIQ+ auch von anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus oder Ableismus[6] betroffen sind. Viele Betroffene melden Übergriffe nicht, was darauf hinweist, dass die Problematik größer ist, als die offiziellen Zahlen vermuten lassen.
LSBTIQ+ stehen vor vielfältigen Herausforderungen im Bereich Gesundheit, die sich direkt auf ihr Wohlbefinden auswirken können. Diskriminierungserfahrungen und gesellschaftliche Stigmatisierung, wie sie beispielsweise durch Hate Crimes entstehen, führen oft zu Minderheitenstress. Dieser Stress belastet die psychische und physische Gesundheit und erhöht das Risiko für Erkrankungen. [wie Depressionen, Herzprobleme, Migräne und Rückenschmerzen.] Gendernormen nicht zu entsprechen, zieht eine Vielzahl sozialer Sanktionierungen mit sich. Internationale sowie vereinzelte regionale Studien weisen darauf hin, dass infolge permanenter Diskriminierung und dem entsprechenden Minderheitenstress queere Person, insbesondere TIN, ein hohes Risiko an Suizidalität aufweisen.
Darüber hinaus sind Präventions- und Gesundheitsangebote häufig nicht auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt ausgerichtet. Viele Angebote ignorieren die Lebensrealitäten von LSBTIQ+. Besonders trans Personen wird der Zugang zu gynäkologischen oder urologischen Untersuchungen erschwert, teilweise sogar verweigert. Inter Personen haben oft traumatische Erfahrungen durch Zwangsoperationen oder andere medizinische Eingriffe gemacht, die schwerwiegende Folgen für ihre Gesundheit haben können. Barrieren bestehen auch bei der psychischen Gesundheitsversorgung: Diskriminierung und mangelnde Sensibilität im Gesundheitssystem erschweren es LSBTIQ+, angemessene Behandlungen zu erhalten. Besonders trans, inter und genderdiverse Menschen sind davon betroffen, ebenso wie geflüchtete LSBTIQ+, LSBTIQ+ mit Behinderung oder LSBTIQ+ in Haftanstalten oder wohnungslose LSBTIQ+. Oftmals behindern gesetzliche Einschränkungen wie ein fehlender Krankenversicherungsschutz, die Verweigerung einer freien Ärzt*innenwahl oder Sprachbarrieren sowohl den allgemeinen Zugang zu gesundheitlichen Leistungen als auch zu spezifischen Leistungen wie Hormontherapien oder therapeutischer Begleitung. Praktiker*innen sollten daher besonders darauf achten, ihre Beratungs- und Unterstützungsangebote niedrigschwellig, sensibel und an die Lebensrealitäten von LSBTIQ+ anzupassen, um Barrieren abzubauen und Gesundheitsrisiken zu minimieren.
Auch im Arbeitsbereich sind LSBTIQ+ häufig von Diskriminierung betroffen. Dies beginnt bereits bei der Jobsuche: Viele Bewerber*innen werden aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, geschlechtlichen Identität oder Geschlechtsmerkmale benachteiligt, etwa indem sie gar nicht erst zu Vorstellungsgesprächen eingeladen oder bei der Vergabe von Stellen übergangen werden. Aber auch Sachbeschädigungen und körperliche Gewalt sind Erfahrungen, die einige LSBTIQ+ im Arbeitsleben machen müssen. Besonders trans und inter Personen erleben solche Diskriminierung überdurchschnittlich oft.
Am Arbeitsplatz setzen sich die Schwierigkeiten fort: Etwa ein Fünftel der LSBTIQ+ Personen berichten von Diskriminierung innerhalb der letzten 12 Monate, bei trans, inter und genderdiversen Menschen liegt dieser Anteil bei über einem Drittel. Die Spannbreite der Erfahrungen reicht von Beleidigungen und Ausgrenzungen bis hin zu strafrechtlich relevanten Vorfällen wie Sachbeschädigung und körperlicher Gewalt. Darüber hinaus fühlen sich viele LSBTIQ+, insbesondere inter Personen, an ihrem Arbeitsplatz nicht wohl oder sicher. Dies kann dazu führen, dass sie ihre Identität aus Angst vor negativen Konsequenzen verbergen müssen, was zusätzlichen Stress verursacht. Diskriminierung äußert sich auch in arbeitsrechtlich relevanten Nachteilen, etwa durch ungerechtfertigte Versetzungen oder Kündigungen. In der Konsequenz haben viele LSBTIQ+ schlechtere Aufstiegschancen und geringere Arbeitsplatzsicherheit.
LSBTIQ+ Personen sind auf dem Wohnungsmarkt häufig von struktureller Diskriminierung betroffen. Laut dem Grundrechtsreport hat ein Viertel der Befragten Diskriminierung bei der Wohnungssuche erlebt. Regionale Studien legen nahe, dass die tatsächliche Zahl sogar noch höher sein könnte: LSBTIQ+ berichten verstärkt von Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, und sind überdurchschnittlich oft von Wohnungslosigkeit betroffen. Trans, inter und genderdiverse Menschen haben nochmals mehr Schwierigkeiten.
Häusliche Gewalt, die aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität der Betroffenen erfolgt, kann eine zusätzliche Ursache für Wohnungsnot sein. Besonders schwer ist die Lage für LSBTIQ+, die weiteren Diskriminierungen ausgesetzt sind, etwa migrantische, BPoCs oder geflüchtete LSBTIQ+. Diese Gruppen erleben neben queerfeindlicher auch rassistische Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt. Lesbische Frauen berichten zudem häufig, dass sie aufgrund nicht bezahlbarer Mieten auf Wohnungen ausweichen müssen, die sich in Gegenden befinden, in denen sie sich nicht sicher fühlen. Die Benachteiligungen in anderen Lebensbereichen wie Gesundheit, Arbeit oder öffentlichem Leben verschärfen die Problematik zusätzlich. Wer von Wohnungslosigkeit bedroht ist, hat oft weniger Ressourcen, um diese Situation zu bewältigen. Dadurch entstehen schwer durchbrechbare Kreisläufe: Ohne Wohnung ist es schwieriger, eine neue Wohnung zu bekommen, Arbeit zu finden, Transferleistungen zu beantragen oder Zugang zum Gesundheitssystem zu erhalten.
[2]
https://bausteine-antimuslimischer-rassismus.de/glossar/ebenen-der-diskriminierung
https://ratschlag-kulturelle-vielfalt.de/site/assets/files/1094/institutioneller_rassismus_in_der_deutschen_gesellschaft.pdf>
https://rise-jugendkultur.de/expertise/rassismus/struktureller-rassismus-und-drei-seiner-erscheinungsformen/institutioneller-rassismus
[3]
https://diversity-arts-culture.berlin/woerterbuch/klassismus
https://andreaskemper.org/klassismus/
[4]
https://report-antisemitism.de
https://www.kiga-berlin.org/en/topic/antisemitismus
https://www.stopantisemitismus.de
Verwobenheit verschiedener Diskriminierungsformen
Das Konzept der Intersektionalität – eine Einführung
Der Begriff Intersektionalität wurde von der US-amerikanischen Juristin Kimberlé Crenshaw geprägt und beschreibt, wie sich verschiedene Formen der Diskriminierung in konkreten Diskriminierungserfahrungen überschneiden und in ihrer Wechselwirkung spezifisch wirken. Dass Gerichte in den USA Klagen Schwarzer Frauen gegen Massenentlassungen ablehnten, führte Crenshaw in ihrer Analyse darauf zurück, dass die Rechtsprechung Diskriminierung nur einseitig betrachtete, entweder als Rassismus oder Sexismus, aber nicht beides gleichzeitig. Crenshaw zeigte, dass Schwarze Frauen oft unter dieser doppelten Diskriminierung leiden, die nicht einfach addiert, sondern als ein verwobenes System betrachtet werden muss.
Intersektionalität bedeutet einerseits zu erkennen, dass Menschen nicht nur einer, sondern mehreren Diversity-Kategorien angehören, wie Geschlecht, Herkunft, Behinderung oder sozialem Status. Diese Überschneidungen können zu komplexen Formen der Benachteiligung führen und zeigen sich in konkreten Situationen ganz spezifisch. Wenn eine Person beispielsweise infolge von Gewalt nach einem queeren Outing ihr Zuhause verlassen muss, macht es einen erheblichen Unterschied, auf welche sozialen und materiellen Ressourcen sie zurückgreifen kann: Habe ich ein Netzwerk, an das ich mich wenden kann? Habe ich ein eigenes Zimmer, wenn ich bei Freund*innen unterkomme? Kann ich mir ein Hotelzimmer leisten, wenn ich nirgendwo anders unterkommen kann? Wenn das Jobcenter erst nach drei Monaten Bearbeitungszeit zahlt, kann ich dann diese Zeit überbrücken? Auch, über welchen Aufenthaltsstatus eine Person verfügt, hat erheblichen Einfluss auf diese Situation. Machen LSBTIQ+ neben queerfeindlichen auch andere Diskriminierungserfahrungen wie Rassismus, Klassismus oder Ableismus, können Effekte dieser Diskriminierungserfahrungen nur verstanden werden, wenn man die Verflechtungen berücksichtigt. In Beratungssettings gilt es, diese unterschiedlichen Folgen zu verstehen und in die Beratungspraxis einfließen zu lassen.
Rassismus hat seine Wurzeln in kolonialen Zeiten, seine Folgen und Spuren sind jedoch bis heute tief in die deutsche Gesellschaft eingewoben.
Rassismus sowohl Kernelement rechter Ideologien als auch gesamtgesellschaftlich tief verankert. Rassismus zu erkennen oder nicht zu (re)produzieren, braucht lange Auseinandersetzungen mit der eigenen Eingebundenheit in soziale Machtverhältnisse und verinnerlichten Vorurteilen. Rassismus und Diskriminierung zeigt sich auf individueller, institutioneller und kultureller Ebene und richtet sich gegen Schwarze und People of Colour (BiPoC) oder gegen Menschen mit Bezügen zu Osteuropa aufgrund ihrer vermeintlichen Hautfarbe oder Herkunft. Formen von Rassismus sind zum Beispiel Anti-Schwarzer Rassismus, Anti-Muslimischer Rassismus, oder Antiromaismus. Individuelle Praxen von Rassismus umfassen direkte Diskriminierungen wie Mikroaggressionen (z. B. komische Blicke oder Suggestivfragen wie „Woher kommst du wirklich?“), unabsichtliche Stereotypisierungen und Zuschreibungen oder offene rassistische Beleidigungen.
Institutionalisierte Praxen von Rassismus zeigen sich in diskriminierenden Strukturen, z. B. durch die häufigere Zuweisung von Kindern mit Migrationshintergrund auf Förderschulen, Racial Profiling durch die Polizei, diskriminierende Praxen gegen BiPoC in Behörden oder durch unzureichende Schmerzbehandlungen für BiPoC im Gesundheitswesen.
Rassismus auf der kulturellen Ebene äußert sich in stereotypen Darstellungen in Medien und Lehrmaterialien, rassistischen Traditionen wie im Karneval oder der kulturellen Aneignung beispielsweise in der Mode. Auch rassistische Sprachbilder, die individuell geäußert werden, werden auf der kulturellen Ebene geprägt. Auch Debatten um sogenannte ‚No-go-Areas‘, im Umfeld beispielsweise der Fußballweltmeisterschaft 2006, wonach es für BiPoCs und/oder Migrant*innen gefährlich sein kann, bestimmte Bezirke und Regionen Deutschlands zu bereisen, verdeutlichen die Verankerung von Rassismus auf kultureller Ebene.
Rassifizierte Menschen und BiPoC erleben auf allen Ebenen Rassismus, ihr Alltag ist von diskriminierenden Praktiken geprägt, zum Beispiel durch beleidigende Sprüche, die sich auf ihre vermeintliche Hautfarbe oder Herkunft reduziert, aber auch durch Übergriffe und nicht ausreichende Schutzmaßnahmen. Rechte rassistische Übergriffe werden häufig aufgrund des strukturell verankerten Rassismus der Dominanzgesellschaftlich nicht oder nicht ausreichend verfolgt.
LSBTIQ+ Personen, die von Rassismus betroffen sind, haben spezifische Herausforderungen im Hinblick auf Wohnungslosigkeit und Wohnen. Sie haben oft größere Schwierigkeiten, Wohnraum zu finden, da sie aufgrund von Vorurteilen und rassistischen Einstellungen von Vermieter*innen abgelehnt werden. Auch in vielen Wohngegenden können sie Anfeindungen erleben, was ihre Wohnsituation unsicherer macht. Als queere Personen sind sie zusätzlich Diskriminierung und Vorurteilen im Wohnumfeld ausgesetzt. Dies führt sowohl bei der Wohnungssuche als auch im Alltag zu Unsicherheiten, insbesondere wenn ihre queere Identität sichtbar oder bekannt ist. Die Kombination dieser beiden Diskriminierungsformen erhöht das Risiko, von sicherem und bezahlbarem Wohnraum ausgeschlossen zu werden. Queere rassifizierte Menschen haben zudem oft erschwerten Zugang zu Netzwerken und Ressourcen, die sie bei der Suche nach sicherem Wohnraum unterstützen könnten. Dadurch erhöht sich ihr Risiko, wohnungslos zu werden oder in unsicheren Wohnverhältnissen leben zu müssen.
Queere Geflüchtete und Migrant*innen stellen eine vielfältige Gruppe mit eigenen Flucht- und Migrationsgeschichten dar. Sie unterscheiden sich in Alter, Herkunft, Sprache, Geschlechtsidentitäten, und Bildungszugang, sind jedoch oft gemeinsam von Vorurteilen, Ausgrenzung und rassistischer und queerfeindlicher Diskriminierung betroffen. Da Queerfeindlichkeit in den Herkunftsländern auch ein Fluchtgrund sein kann, sind queere Geflüchtete oft aufgrund traumatischer (Flucht-)Erfahrungen außerdem auf besondere Unterstützung angewiesen. Die Differenzierungen können dabei helfen, die Komplexität, die diese Menschen in ihrem Alltag erleben, besser zu verstehen.
Diese Diskriminierungen wirken sich besonders in Bereichen wie dem Zugang zu Wohnraum aus, wo Intersektionalität – das Zusammenspiel mehrerer Diskriminierungsformen – eine große Rolle spielt.
Für queere Geflüchtete ist der Zugang zu stabilem Wohnraum besonders schwierig. Ihre Bleibeperspektive in Deutschland hängt stark von Herkunft und Fluchtgründen ab, und oft haben sie nur begrenzte finanzielle Mittel. Der generelle Mangel an bezahlbarem Wohnraum verschärft diese Lage, denn viele Vermieter*innen bevorzugen Mieter*innen mit „sicherem“ Aufenthaltsstatus. Beratungsstellen berichten zudem von systematischer Benachteiligung bei Behörden und Ämtern, was den Zugang zu Wohnraum für queere Geflüchtete weiter erschwert.
Auch innerhalb von Unterkünften und ausgehend von Vermieter*innen erleben LGBTQ+ Geflüchtete Diskriminierung. Viele queere Geflüchtete fühlen sich gezwungen, ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität so gut wie möglich zu verbergen, aus Angst, Ablehnung oder sogar Gewalt zu erfahren. Diese Unsicherheit erhöht das Risiko, wohnungslos zu werden oder in prekären Wohnverhältnissen zu leben.
Auch innerhalb der LGBTQ+ Community sind queere Geflüchtete nicht automatisch sicher. In Räumen, die als offen und inklusiv gelten, erfahren sie Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft, Sprache oder ihres Aufenthaltsstatus. Diese Mehrfachdiskriminierung kann zu Isolation und einem erschwerten Zugang zu Unterstützungsnetzwerken führen. So fühlen sich queere Geflüchtete häufig ausgegrenzt, selbst in Gemeinschaften, die eigentlich Schutz bieten sollten.
Nicht nur Geflüchtete, sondern auch Migrant*innen ohne Fluchterfahrung sind oft benachteiligt, wenn es um den Zugang zu Wohnraum geht. Viele Vermieter*innen bevorzugen Bewerber*innen mit „deutsch klingenden“ Namen und deutscher Staatsbürgerschaft. Sprachbarrieren und fehlendes Wissen über das deutsche Mietrecht machen die Wohnungssuche zusätzlich schwer. Insgesamt zeigt sich, dass queere Migrant*innen und Geflüchtete einer doppelten Diskriminierung ausgesetzt sind: Sie werden sowohl aufgrund ihrer Identität als auch wegen ihres Migrationshintergrunds benachteiligt. Dies führt dazu, dass sie häufiger in unsicheren Wohnverhältnissen leben, überteuerte Mieten zahlen oder in weniger sicheren Gegenden wohnen müssen.
Queere Sexarbeiter*innen machen in Beratungsstellen permanent diskriminierende Erfahrungen. Sie werden stigmatisiert und ausgegrenzt. Die Themen, mit denen queere Sexarbeitende Beratungsstellen aufsuchen, werden oft nicht ernst genommen. Bei binären geschlechterspezifischen Angeboten werden sexarbeitende trans Personen oftmals abgewiesen, wenn zum Beispiel Frauenberatungsstellen aufgrund von transfeindlichen Einstellungen trans Frauen keinen Zugang gewähren.
Prekäre Situation von queeren Sexarbeiter*innen
Queere Sexarbeiter*innen stehen am Schnittpunkt mehrerer Diskriminierungssysteme. Sie erleben häufig nicht nur Stigmatisierung aufgrund ihrer Tätigkeit, sondern auch Queerfeindlichkeit und andere Diskriminierungen wie Klassismus, Rassismus und Ableismus. Trans* und nicht-binäre Personen in der Sexarbeit werden besonders stark marginalisiert. Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen können die Vulnerabilität für Personen erhöhen.
Häufig findet Sexarbeit in prekären Verhältnissen statt. Es fehlt an sicheren Arbeitsräumen, oft haben queere Sexarbeitende keine Dokumente, die ihre Geschlechtsidentität widerspiegeln, was den Zugang zu grundlegenden Leistungen erschwert. Aufgrund fehlender Papiere ist der Zugang zu allgemeiner und auch zu einer spezifischen Gesundheitsversorgung häufig erheblich erschwert. Soziale Unterstützungsangebote und Beratungsstellen sind hingegen oft nicht für die Bedarfe von queeren Sexarbeiter*innen ausgelegt, transfeindliche Einstellungen führen dazu, dass sie in binären geschlechtsspezifischen Angeboten wie Frauenhäusern oder Beratungsstellen für Männer diskriminiert, zum Teil sogar abgewiesen werden, während sie in der je anderen Beratungsstelle nicht die richtigen Angebote finden. Zugleich sind viele Sexarbeiter*innen infolge existenzieller Notlagen besonders auf Unterstützungsangebote angewiesen, so dass sie diese dennoch aufsuchen und permanent mit Diskriminierungserfahrungen umgehen müssen. Queere Sexarbeit bleibt im öffentlichen Diskurs oft unsichtbar, was ihre Isolation und das Fehlen von Unterstützungsnetzwerken verstärkt.
Schlussfolgerungen für die Praxis:
Wohnungslosigkeit bei LSBTIQ+-Personen ist oft eine Folge von Queerfeindlichkeit im familiären, sozialen und/oder regionalen Umfeld. Queerfeindliche Diskriminierung und Gewalt zwingt viele LSBTIQ+ Personen, ihre Wohnorte zu verlassen, um Schutz vor Gewalt und Diskriminierung zu suchen. Auch der Wunsch, Orte zu finden, an denen queere Identität entwickelt und gelebt werden kann, ist ein Grund, bestehende Wohnorte verlassen zu müssen. Oft fehlen jedoch finanzielle Mittel und Netzwerke für eine Bewältigung der damit einhergehenden Wohnungsnot. Viele queere Personen entscheiden sich trotzdem, in unsicherere, aber queerfreundlichere Regionen oder Städte wie Berlin zu ziehen oder auch zu flüchten, um ein Leben in Anerkennung und Entwicklung ihrer queeren Identität verwirklichen zu können – auch wenn dies mit Risiken verbunden ist.
Eine zentrale Diskriminierungsform, die alle wohnungslosen Menschen betrifft, ist Klassismus. Klassismus führt dazu, dass armen Menschen stereotype persönliche Defizite zugeschrieben werden. In der Folge werden ihre Perspektiven und Bedürfnisse nicht ernst genommen, ihnen grundlegende Rechte verweigert und sie sind einem erhöhten Risiko physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt. Für LSBTIQ+ erhöht sich dieses Risiko um ein Vielfaches. Die Vulnerabilität für wohnungslose LSBTIQ+ verstärkt sich wiederum in der Verwobenheit mit weiteren Diskriminierungserfahrungen wie Rassismus, Ableismus und Altersdiskriminierung. Wohnungslosigkeit erschwert es für alle, alltäglichen Grundbedürfnissen nachzukommen und führt zu einem Verlust an Privatsphäre und Sicherheit. Für queere Menschen ist eine fehlende Privatssphäre darüber hinaus mit besonderen Herausforderungen verbunden: Um Diskriminierung eizu vermeiden, müssen viele queere Personen ständig ihr Erscheinungsbild und Verhalten anpassen. Die Belastung durch Diskriminierung und durch Strategien des Überlebens ist erheblich, gleichzeitig schützen diese Strategien nicht immer vor Übergriffen. Viele erleben dadurch eine reduzierte Lebensqualität, die insbesondere von trans Personen als reiner Überlebensmodus empfunden wird. Das System der Wohnungsnotfallhilfe ist weitestgehend binär cisgeschlechtlich und heteronormativ strukturiert, was queere Menschen ausschließt oder ihnen den Zugang erschwert. Wohnungslose Frauen und LSBTIQ+ sind zudem häufig verdeckt wohnungslos und/oder werden unsichtbar gemacht. Um die wenigen Plätze und Anlaufstellen im Hilfesystem mit Fokus auf Frauen, nochmal weniger Plätze mit Fokus auf LSBTIQ+, entsteht durch den hohen Bedarf Konkurrenz. Notunterkünfte bieten für queere Personen keine sicheren Räume, was einige LSBTIQ+ Personen dazu zwingt, gefährliche Nächte im Freien zu verbringen. Die Problematik zeigt, dass es dringend notwendig ist, die Lebensrealitäten wohnungsloser LSBTIQ+ Personen zu verstehen, um spezifische Hilfsangebote zu schaffen. Solche Angebote müssen sowohl die Erfahrungen von queerfeindlicher Diskriminierung als auch die oft unsichtbaren Bedarfe dieser Gruppe berücksichtigen.
Gestaltung diskriminierungssensibler Beratungsstrukturen
Handlungsempfehlungen
Das hauptsächlich binärgeschlechtlich aufgeteilte System der Wohnungsnotfallhilfe sieht sich in den letzten Jahren mit vermehrtem Bedarf und Anfragen von trans*geschlechtlichen Personen konfrontiert. Verwehren binärgeschlechtlich aufgeteilte Einrichtungen Personen den Zugang zu entsprechenden Frauen – bzw. Männer-Einrichtungen auf Grund ihrer Trans*Geschlechtlichkeit, setzen sich gesellschaftliche Ausschlüsse fort.
Nachfolgend soll ein Bericht aus der Praxis einer stationären Einrichtung der Wohnungsnotfallhilfe für Frauen* den Prozess der Öffnung in Bezug auf Trans*Geschlechtlichkeit kurz skizzieren. Hieraus lassen sich sowohl Möglichkeiten als auch noch vorhandene Problemfelder ableiten.
Die Einrichtung „Hannah – Wohnen für Frauen“ der Diakonie Frankfurt und Offenbach ist eine stationäre Übergangseinrichtung für Frauen* nach dem SGB XII §67 ff. zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Sie ist aufgeteilt in einen stationären Bereich, in welchem wohnungslose Frauen* in Einzelappartements übergangsweise in sozialpädagogisch begleitetem Setting leben können und einen Notübernachtungsbereich mit Einzelzimmern und gemeinschaftlich genutzten Aufenthalts- und Sanitärräumen, in welchem Frauen* kurzfristig und niedrigschwellig in akuten Notsituationen übernachten und Beratung in Anspruch nehmen können.
Im Verlauf der Jahre 2020 – 2022 häuften sich Aufnahme-Anfragen von trans*geschlechtlichen Frauen, Beratungsstellen und Behörden an die Einrichtung, insbesondere für den Notübernachtungsbereich. Es wurde offensichtlich, dass der Zugang von hilfesuchenden trans*geschlechtlichen Frauen zu Frauen-Einrichtungen bzw. speziell auch zu Notübernachtungen insgesamt erheblich erschwert ist. Im Bewusstsein dessen, stellte sich den Mitarbeiterinnen die Frage nach Veränderung und neuen Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Situation. Daraufhin wurde im Sommer 2022 ein extern moderierter Konzeptionstag zum Thema organisiert, an welchem auch weitere Mitarbeiterinnen einer zweiten Frauen-Einrichtung mit Wohngruppen-Setting teilnahmen. Im Rahmen eines Reflexionsprozesses stellten sich unter anderem folgende Fragen:
Als besonders schwierig wurde u.a. die Diskussion um Grenzsetzungen bezüglich körperlicher Merkmale empfunden. Wer bestimmt beispielsweise, welche Person als ‚zu männlich‘ oder als ‚weiblich genug‘ anerkannt wird? Hier zeigte sich, dass es auf manche Fragen (noch) keine klaren Antworten gab, ein Öffnungsprozess aber trotzdem beginnen konnte.Im Rahmen des Konzeptionstages wurde ein gemeinsamer Konsens erarbeitet, dass Trans*Frauen Zugang sowohl zur Notübernachtung mit gemeinschaftlich genutzten Räumen als auch zum Wohngruppensetting ermöglicht werden soll und eine Aufnahme nicht mehr generell abgelehnt wird.
Dafür wurden unter anderem folgende Kriterien entwickelt:
Mittlerweile wurden in beiden Bereichen der Einrichtung gute Erfahrungen mit der Aufnahme von trans*geschlechtlichen Frauen* gemacht. Auch wurde eine erste Frau* im stationären Setting aufgenommen, die bei Aufnahme ganz am Anfang ihres Transitionsprozesses stand und zum großen Teil noch ‚männlich‘ gelesen wurde. Es herrschte schnell eine Akzeptanz und Anerkennung als Frau* durch die anderen Bewohnerinnen. Größere Irritationen blieben aus, kleinere konnten in Gesprächen mit Mitarbeitenden bearbeitet werden. Diese Kurzbeschreibung zeigt, wie es möglicherweise besser gelingen kann, mit binärgeschlechtlichen Strukturen und Vorstellungen zu brechen und trans*geschlechtliche Personen in bestehende Angebote der Wohnungsnotfallhilfe zu integrieren, anstatt Ausschlüsse zu reproduzieren oder automatisch auf Einzelunterbringungen zurückzugreifen. Ein partizipativer und antidiskriminierender Umgang mit Trans*Personen richtet sich immer auch nach den individuellen Bedürfnissen und Wünschen der Beteiligten selbst und kombiniert zum einen die Möglichkeiten von spezifiziertem Schutzraum und zum anderen die Integration in vorhandene Angebote durch Umdenken und Reflexion von bestehenden binärgeschlechtlichen Strukturen.
Do’s
Don’ts
Do’s
Don’ts
Do’s
Don’ts
Do’s
Don’ts
Do’s
Don’ts
Verzeichnis
Relevante Angebote
Excel-Verzeichnis relevanter Angebote zu …
…. queerspezifischen Antidiskriminierungsprojekten, queeren Beratungsstellen und Unterstützungsnetzwerken u.a.
Glossar
Hier finden Sie eine Auswahl an Links zu bereits bestehenden Glossaren mit Begrifflichkeiten zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Die Vielfalt und Perspektivenvielfalt der Begrifflichkeiten spiegelt sich in zahlreichen Glossaren wider. An dieser Stelle verweisen wir auf eine Auswahl bestehender Glossare, ohne eine Rangfolge zu setzen oder zu implizieren, dass diese Glossare die besten sind. Jedes Glossar bietet wertvolle Orientierung und erklärt mitunter unterschiedliche Begriffe – alle sind gleichermaßen hilfreich und empfehlenswert.